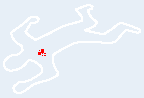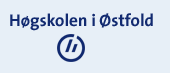
|
Modi operandi
|
|
|
Sabine Richter
Tatort Oslo |
|
Sammendrag:
Jedes Jahr werden in Norwegen zwischen 20 und 25 neue Kriminalromane sowie eine Unzahl von Kriminalgeschichten auf den Markt gebracht. Norwegische Krimis werden heute sehr viel öfter in andere Sprachen, vor allem ins Deutsche, übersetzt, als jemals zuvor.
Der sogenannte "Osterkrimi" ist in Norwegen selbst mittlerweile zu einer Tradition geworden, die schon fast einem kollektiven Frühlingsritual gleicht. Dem, nach meinem Dafürhalten, rituellen Charakter der Krimis als besondere Variante der formelhaften Unterhaltungsliteratur und der spielerischen Auseinandersetzung mit diesen traditionellen Vorgaben kommt besondere Bedeutung zu, will man die Anziehungskraft für den enthusiastischen Leser erklären
Eine gelungene Kriminalgeschichte gibt dem Leser meist die Genugtuung des Wiedererkennens von Handlungsmustern im fiktiven Geschehen und der Gesellschaft, die in der zu erzählenden Geschichte prismenhaft gespiegelt wird. Dies kann neue Blickwinkel für die Deutung eines Aspektes typisch norwegischer Mentalität eröffnen.
Dieser Artikel handelt in Ansätzen - denn dies ist im Grunde ein weites Feld - vom Mythos um die Stadt, den Mythen der Stadt und der Stadt als literarischem Tatort, wie er in der Summe der Geschichten und Legenden um sie zum Ausdruck kommt: Es geht um die Stadt als Seelenlandschaft, als Abgrund, als Ort der Verführung und der Schrecken, die Stadt als Kulisse für Verfolgungsjagd und Bestrafung. Und nicht zuletzt geht es auch um die Stadt als Gegenstück zur kleinen, überschaubaren Welt der Kernfamilie innerhalb einer augenscheinlich transparenten und sicheren norwegischen Gesellschaft.
Ausgangspunkt für meine Überlegungen sind neuere norwegische Krimis solcher Autoren wie Kjersti Scheen, Unni Lindell, Pernille Rygg u.a., die Oslo zum Schauplatz ihrer Kriminalgeschichten erkoren haben.
 Forfatterens bidrag som PDF-dokument
Forfatterens bidrag som PDF-dokument